
Warum sich Flächenpooling bei Windenergie immer mehr durchsetzt
Seit den 2000er-Jahren gewinnen sogenannte Poolpachtmodelle bei Windparks zunehmend an Bedeutung. Wir erklären was genau man darunter versteht und warum diese Modelle immer beliebter werden – obwohl einige Landeigentümer*innen dabei weniger Einnahmen erzielen könnten als beim Abschluss individueller Pachtverträge.
Flächenpooling einfach erklärt
- Das Flächenpooling ist ein Beteiligungsmodell bei Windenergieprojekten, bei dem mehrere Landeigentümer*innen ihre Flächen gemeinsam verpachten.
- Die Gesamtvergütung wird gerecht auf alle Beteiligten verteilt – so können auch Landeigentümer*innen profitieren, auf deren Grundstück keine Windenergieanlage steht. Diese Verteilung erfolgt nach einem festgelegten Schlüssel mit Bezug auf Aspekte wie Flächengröße oder Nähe zur Anlage.
- Durch Flächenpooling können also mehr Menschen in der Region von einer Windenergieanlage profitieren.
Was ist Flächenpooling?
Kurz gefasst ist Flächenpooling ein solidarisches Vergütungssystem für Windenergieprojekte. Das bedeutet: Anstelle individueller Pachtverträge kommt ein einheitlicher Poolpachtvertrag zum Einsatz. Dieser regelt die Verteilung der Einnahmen aus dem Betrieb der Windenergieanlagen innerhalb eines festgelegten Eignungsgebiets, dem sogenannten Flächenpool. Anders als bei Einzelverträgen werden dabei alle Landeigentümer*innen im Gebiet anteilig berücksichtigt. Das Ergebnis: Auch jene, auf deren Grundstück keine Anlage steht, profitieren finanziell – und das stärkt den Zusammenhalt in der Region.

Wie genau funktioniert das Flächenpooling?
Die Poolpachten setzen sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, die bei der Berechnung der Auszahlungen an die Landeigentümer*innen innerhalb des Flächenpools unterschiedlich gewichtet werden. Dabei kann die Eigentümergemeinschaft auch gemeinsam über die tatsächliche Verteilung entscheiden. So arbeiten alle gemeinsam auf ein Ziel hin.
Zu den Bestandteilen der Verteilung gehören beispielsweise unter anderem das Flächenentgelt, das Fundamententgelt sowie die Vergütung für Abstands- und Rotorüberflugflächen. Die Auszahlungen erfolgen anteilig auf Basis dieser Gewichtung. So profitieren alle Grundstücke im Flächenpool – selbst dann, wenn sich keine Windenergieanlage darauf befindet, wie etwa im Fall des Mustergrundstücks B (siehe Grafik).
Die Vergütung bei Flächenpooling
Voraussetzung für die Verteilung der jährlichen Poolgesamtvergütung unter den Landeigentümer*innen des Flächenpools ist, dass alle den gleichen Poolingvertrag abgeschlossen haben.
Die Poolgesamtvergütung selbst setzt sich üblicherweise aus drei Komponenten zusammen, die unterschiedlich gewichtet werden.
Im Folgenden ein Beispiel, wie das in der Praxis aussehen kann.

Flächenentgelt (70%)
(Mustergrundstücke A, B und C)
- Landeigentümer*innen erhalten einen Anteil entsprechend der Fläche, die sie in den Flächenpool eingebracht haben.
- Je größer die Fläche, desto höher der Anteil.
Beispiel:
Wer 10% der Gesamtfläche stellt, erhält 10% des Flächenentgelts.

Fundamententgelt (20%)
(Mustergrundstück A)
- Landeigentümer*innen, auf deren Grundstück Windenergieanlagen stehen, erhalten anteilig 20% der Gesamtvergütung.
- Die Verteilung richtet sich nach der Anzahl der Anlagen auf dem jeweiligen Grundstück im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Windenergieanlagen im Flächenpool.
- Sonderfall: Steht eine Anlage auf mehreren Grundstücken, wird der Anteil entsprechend der Fläche aufgeteilt.
Beispiel:
Gesamtfläche des Anlagenstandorts: 500 m²
Grundstück A: 375m² → 75 %
Grundstück B: 125m² → 25%

Entgelt für Abstands- und Rotorüberflugflächen (10 %)
(Mustergrundstücke A und C)
- Grundstücke, die als Abstands- oder Rotorüberflugfläche genutzt werden, erhalten anteilig 10 % der Gesamtvergütung.
- Die Verteilung erfolgt nach dem Verhältnis der genutzten Fläche zur Gesamtfläche aller Abstands- und Rotorüberflugflächen im Pool.
- Die Größe der erforderlichen Abstandsflächen richtet sich nach den Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes. Einige Länder haben eigene Sonderregelungen eingeführt, um den Ausbau der Windenergie zu erleichtern, Flächen effizienter zu nutzen und bürokratische Hürden bei der Flächensicherung zu verringern.
Beispiel:
In Nordrhein-Westfalen (§ 6 BauO NRW 2018) ist definiert, dass die Größe der Abstandsflächen 30 % (20% in Gewerbe- und Industriegebieten) der Gesamthöhe der Windenergieanlage betragen muss. Bei einer Gesamthöhe von 260 m, muss die Abstandsfläche daher rund 78 m (bzw. 52m in Gewerbe- und Industriegebieten) betragen.

Was sind die Vorteile des Flächenpoolings?
Das Poolpachtmodell bietet einen entscheidenden Vorteil: Es beschleunigt in der Regel die Umsetzung geplanter Windparks. Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
- Zum einen profitieren bedeutend mehr Landeigentümer*innen als beim herkömmlichen Verfahren. Durch die breitere und gerechtere Verteilung der Einnahmen steigt die Akzeptanz vor Ort.
- Zum anderen wird statt vieler unterschiedlicher Einzelverträge nur ein einheitlicher Vertrag – oder inhaltlich standardisierte Verträge – für die Fläche geschlossen. Das spart Zeit und vereinfacht die Umsetzung.
- Hinzu kommt, dass die gebündelte Flächennutzung eine effizientere Planung und bessere Ausnutzung der Windverhältnisse ermöglicht. In der Folge profitieren sowohl der Betreiber als auch die Eigentümergemeinschaft gleichermaßen von einer besseren Windausbeute und stabileren Erträgen.
Das Poolpachtmodell ist also ein wirkungsvolles Instrument, um Windenergieprojekte gerechter, effizienter und konfliktfreier umzusetzen. Es fördert die Akzeptanz in der Region und bringt Vorteile für alle Beteiligten. Kein Wunder also, dass es sich zunehmend durchsetzt.
Warum sich eine Beteiligung am Poolpachtmodell für Landeigentümer*innen lohnt
Gerechte und transparente Vergütung
Alle Landeigentümer*innen im Flächenpool profitieren – unabhängig davon, ob eine Anlage direkt auf ihrem Grundstück steht.
Planbare und stabile Einnahmen
Einheitliche Verträge sorgen für verlässliche Erträge und reduzieren Unsicherheiten.
Stärkere Gemeinschaft, weniger Konflikte
Das Modell fördert Akzeptanz und stärkt den sozialen Zusammenhalt.
Effiziente Projektentwicklung
Bündelung der Flächen erleichtert Planung, Genehmigung und Umsetzung – das spart für alle Zeit und Aufwand.
Langfristiger Mehrwert
Beteiligung am Windpark kann den Flächenwert steigern und das Projektimage in der Region verbessern.
Wie kann man sich am Flächenpooling beteiligen?
Um von den Vorteilen des Poolpachtmodells profitieren zu können, gibt es meist zwei Möglichkeiten:

Eigentümergemeinschaft
In manchen Fällen schließen sich die Eigentümer zu einer Gemeinschaft zusammen – etwa in Form einer GbR oder Genossenschaft. Diese verhandelt mit dem Projektentwickler, verwaltet die Einnahmen und verteilt sie nach einem festgelegten Schlüssel. In vielen Fällen wird dieser Prozess inzwischen auch von Kommunen begleitet oder moderiert. Dennoch erfordert die Umsetzung einiges an Koordination und damit Aufwand.
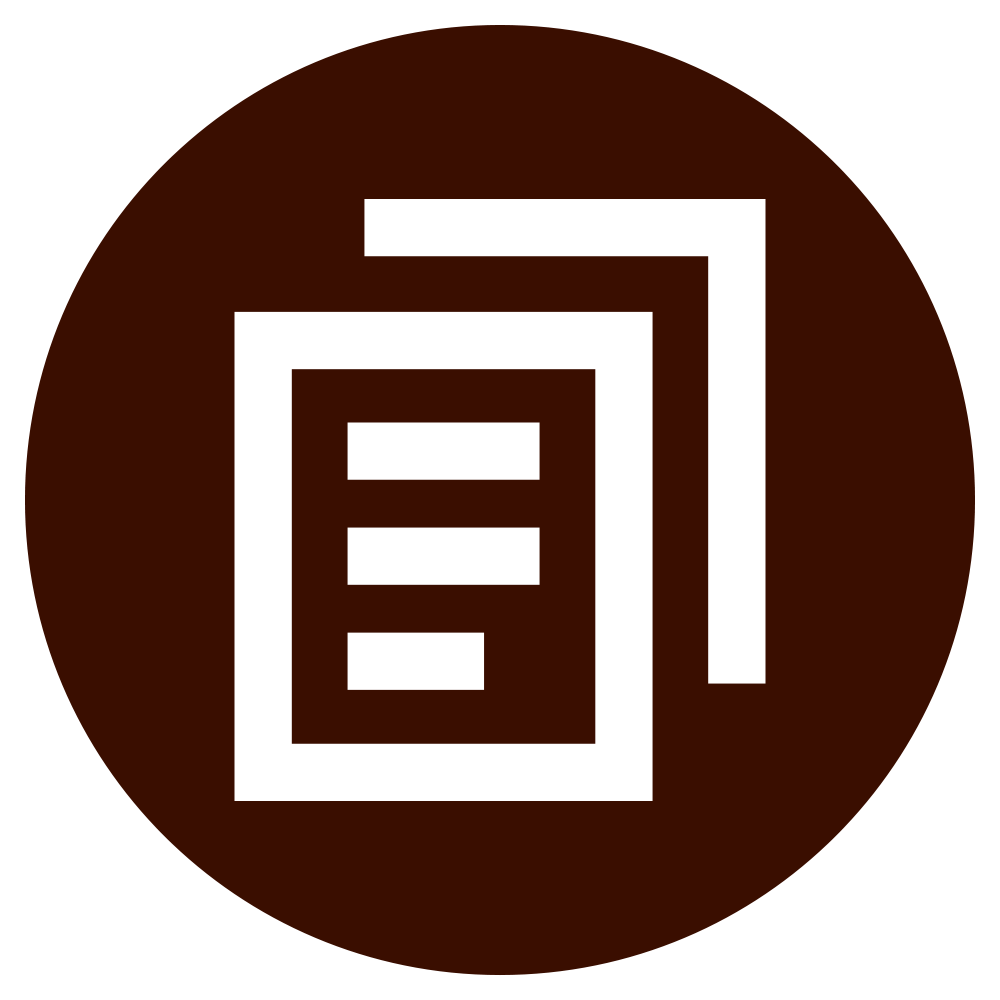
Identischer Vertrag mit dem Projektentwickler
Einfacher und daher gängige Praxis ist es, dass die Landeigentümer*innen bei dem Projektentwickler einen individuellen aber inhaltlich identischen Vertrag abschließen. Diese sogenannten Poolverträge sind standardisiert und lassen sich dadurch unkompliziert umsetzen. So können die Flächenbesitzer*innen von den Vorteilen des Poolpachtmodells, wie schnellere Umsetzung und stabilere Einnahmen profitieren, ohne selbst in Vorleistung gehen zu müssen, während sie sich gleichzeitig auf rechtssichere Verträge verlassen können.
